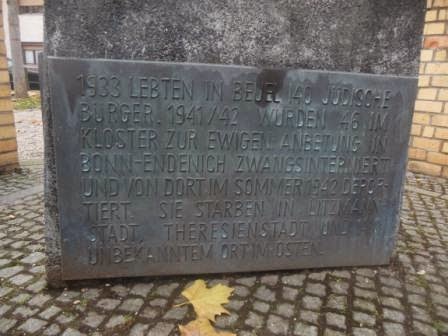|
| Hochkreuz mit Godesburg |
William Turner, 1775 in
London geboren, sein Vater hatte in jungen Jahren sein Talent entdeckt, war ein
Überflieger in der Malerei. Generationen von Impressionisten sollten von ihm
lernen, wie man in welchen Situationen welche Formen, Varianten und
Ausprägungen des Lichtes in welcher Detailtreue darstellen kann.
 |
| Drachenfels |
Turner gewöhnte sich einen
Jahresrhythmus an, dass er von Juni bis September europäische Länder bereiste
und in den Wintermonaten all seine Eindrücke in einer Vielzahl von Aquarellen
und Ölgemälden abarbeitete. In mehreren Reisen durchquerte Turner Deutschland
von West nach Ost, von Nord nach Süd, wobei ihn seine erste Reise 1817 an den
Rhein führte. So landete Turner, nachdem er die Niederlande und Belgien bereist
hatte, am 18. August mit der Postkutsche in Köln.
Da das Zeitalter der
Fotografie noch nicht angebrochen war, sammelte er seine Eindrücke in Skizzenbüchern.
Sie dienten als Tagebücher, in denen er zum einen seine persönlichen Erlebnisse
dokumentierte. Zum anderen zeichnete er mit dem Bleistift in Kleinstarbeit all
diejenigen Details, die er für seine späteren Gemälde brauchte – wie etwa das
Rheinufer mit einem Grünstreifen bewachsen war, wie Boote am Kai standen, wie
sich die Stege zu den Booten neigten usw. Diese Skizzenbücher führte er in
unterschiedlichen Größen mit sich, da er je nach Detaillierungsgrad des
Objektes in unterschiedlichen Größen zeichnete.
 |
| Köln |
Auf Schusters Rappen,
wandernd, erkundete Turner Land und Leute. Die Eisenbahnlinie entlang des
Rheins sollte erst 30 Jahre später gebaut werden, aber anstatt dessen konnte er
einem System aus gut befestigten Straßen aus der Napoleonischen Zeit folgen.
Dabei war er mit einem Tagespensum von rund dreißig Kilometern sogar ein
sportlicher Typ. Damit seine Wanderungen bequem waren, trug er möglichst wenig
unnötigen Ballast. Sein Rucksack war ein sogenannter „wallet“, das war ein
Beutel, der an beiden Enden geschlossen war, mit einem Schlitz in der Mitte, um
die nötigen Dinge hinein zu stecken. Penibel hatte Turner in einem Skizzenbuch
sogar den Inhalt seines „wallet“ notiert: 1 Reiseführer, 3 Hemden, 1 Nachthemd,
ein Rasiermesser, ein Regenschirm mit Hülle, ein paar Strümpfe, ein Wams, ein
halbes Dutzend Bleistifte, 6 Halstücher, ein großes Halstuch, ein Farbkasten. Mancher
Leser wird schätzungsweise zweifeln, ob die Liste vollständig ist.
Während seiner Wanderungen
hielt Turner inne, er nahm sich Zeit, durchleuchtete die Sehenswürdigkeiten mit
mikroskopischem Blick. Er zeichnete, füllte seine Skizzenbücher, machte sich
Notizen, damit seine Zeichnungen eine solche Detailtiefe hatten, um sie in
späteren Gemälden verwenden zu können.
Am 19. August 1817
übernachtete er in Bonn, am nächsten Tag war er hingerissen von den Ausblicken
auf den Drachenfels und das Siebengebirge. Den Drachenfels zeichnete er in sein
Skizzenbuch mit dem größten Format, das war das „rhine-book“. Eine längere
Weile hielt er sich am Hochkreuz und an der Godesburg auf, um Außenränder und
Details möglichst genau zu skizzieren. Dann wanderte er weiter bis nach
Remagen, wo er übernachtete. Auf dem Weg dorthin hielt er den Ausblick auf
Erpel und Linz sowie die Aussicht in der anderen Richtung auf die
Apollinaris-Kirche in einem kleineren Skizzenbuch fest, das war das „waterloo-and-rhine-book“.
Der 21. August 1817 muss ein
ziemlicher Gewaltmarsch gewesen sein, denn er wanderte in einem Stück von
Remagen nach Koblenz. Somit zeichnete er an diesem Tag nur eine ausführliche
Skizze, das war der Felsen „Hammerstein“ auf der anderen Rheinseite des
Brohltales.
 |
| Moselbrücke Koblenz |
Dafür blieb er zwei Nächte
in Koblenz. Koblenz war seine Stadt. Er war wie gefesselt von der Moselbrücke,
dem Moseluferpanorama, der Mündung der Mosel in den Rhein und der Festung
Ehrenbreitstein. Jahre später, zog es Truner immer wieder nach Koblenz zurück. 25
Jahre sollte es aber dauern, bis er eines seiner Meisterwerke malte, das war
die Moselbrücke mit der Festung Ehrenbreitstein.
Im Mittelrheintal widmete er
sich dann den Burgen, das waren Stolzenfels, Lahneck, die Marksburg, Katz und
Maus. Bis Bingen war er wandernd unterwegs, das letzte Stück nach Mainz fuhr er
mit dem Schiff. Ab Mainz ging es dann nach Köln zurück, wobei er fast durchweg
das Schiff benutzte, mit einer Ausnahme: die Perspektive auf den Rolandsbogen
war komplett anders, daher verließ er das Schiff. Am 29. August 1817 wechselte
er auf ein Boot, ruderte um die Insel Nonnenwerth
herum. Er studierte die Vielschichtigkeit der Perspektiven, wie der
Rolandsbogen in Szene gesetzt wurde. In seinem Gemälde rückte er später die
Proportionen zurecht, ließ den Rhein breiter wirken, die Felsen steiler, den
Rolandsbogen noch mächtiger. Solch einen Blick konnte er nur vom Rhein aus
einfangen.
Am 29. und 30. August 1817 übernachtete er in
Köln, wobei der den unvollendeten Dom und das Rathaus zeichnete. Danach reiste
er ab in Richtung England. Im Winter des Jahres 1817/1818 verarbeitete er eine
Vielzahl seiner Skizzen zu Gemälden. Das Skizzenbuch verkaufte er anschließend
an einen Kunsthändler, der Walter Fawkes hieß.
Sieben Jahre später, 1824,
verschlug es Turner abermals an den Rhein. Er reiste nach Lüttich, fuhr von
dort aus die Maas aufwärts. Bis Verdun, von dort aus ritt er nach Metz,
wechselte dort auf das Schiff und fuhr die Mosel entlang. Mehrere Tage
verweilte er in Trier und in Cochem, wo er detailtreue, ganzseitige Skizzen
fertigte. Zwei Tage blieb er vom 1. bis zum 3. September in Koblenz. Auf der
Rückreise nach Köln befasste er sich abermals mit dem Felsen Hammerstein, mit
dem Drachenfels, dem Siebengebirge und mit der Stadt Köln selbst. Erstmals
fertigte er auf dieser Reise eigene Skizzen von Düsseldorf und von Aachen an.
1839 unternahm Turner eine weitere Reise an die Mosel und an den Rhein.
Quelle: Cecilia Powell, William Turner in Deutschland